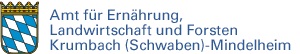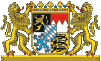Ein Blick in die Zukunft unserer Wälder?
Mittelschwaben trifft Frankenwald
Stellen Sie sich einen typisch mittelschwäbischen Wald vor. Sie haben das Bild eines dicht bestockten Fichtenwaldes vor sich? Der könnte genauso auch im Frankenwald stehen: die Fichte prägte bisher das Bild der nordbayerischen Gegend, 2012 machte sie laut Bundeswaldinventur 70 Prozent der Wälder aus. Heute sieht der Landkreis Kronach, der große Teile des Frankenwaldes umfasst und mit etwa 60 Prozent Waldanteil zu den drei walreichsten Bayerns zählte, häufig kahl und trostlos aus. Seit 2018 wird die Gegend durch den Borkenkäfer schier überrannt. Das gefährdet nicht nur die Biodiversität , sondern beeinträchtigt auch die wirtschaftliche Stabilität der Forstwirtschaft in der Region.
Was war passiert?
In den Jahren 2018 bis 2020 folgte ein trockener, heißer Sommer auf den Nächsten, die Borkenkäfer-Population hat sich von Jahr zu Jahr immer weiter aufgebaut. Dem anfänglichen Befall mit Kupferstecher, der schwer zu erkennen ist, folgte der Buchdrucker, der trotz größter Anstrengungen zur Bekämpfung und Aufarbeitung im Winterhalbjahr nicht zurückgedrängt werden konnte. Erschwerend kam hinzu, dass durch Corona 2020 die Holzlogistik komplett zusammenbrach. Das Holz konnte also nur schwer bis gar nicht abgefahren werden.
Waldschutz immer ernst genommen
Jens Haertel, Bereichsleiter Forsten am AELF Coburg-Kulmbach, schickt vorweg, was die Förster in vielen Regionen Bayerns erleben: "Wir haben hier den Waldschutz bisher immer intensiv begleitet und wurden dem Borkenkäfer auch immer wieder Herr. Daher hat sich aber auch wenig Bewusstsein entwickelt, dass man jetzt schon dringend mit dem Waldumbau beginnen muss." Der immer wieder dringend angemahnte Voranbau mit Mischbaumarten war somit in vielen Privatwäldern nicht oder nur selten erfolgt.
Möglichkeiten der Förderung ausgeschöpft
2020 ging es so nicht weiter, es mussten neue Wege beschritten werden. Die Möglichkeiten höherer Förderung durch Schutzwaldausweisung führte zu einer deutlichen Verbesserung. Die Motivation der Waldbesitzer stieg, auch wenn die Aufarbeitung selbst damit noch defizitär war. Als 2021 die Logistik durch Corona völlig zum erliegen kam, gab es kurzzeitig sogar Fördermittel für das Hacken ganzer Stämme. 2021 wurden mit 25 Millionen Euro ein Viertel der gesamten forstlichen Fördermittel in Bayern allein im Frankenwald ausgegeben.
Die Krise schweißt zusammen
In den Forstrevieren sind mittlerweile teils drei bis vier Förster tätig, um die Flut an Arbeit zu bewältigen. Alle forstlichen Akteure, die Forstverwaltung, Bayerischen Staatsforsten und die Waldbesitzervereinigungen (WBV), arbeiten noch enger zusammen. Letztere sind mittlerweile ebenfalls gut aufgestellt. Die WBV Kronach-Rothenkirchen vermarktet mittlerweile 250.000 Festmeter pro Jahr – zum Vergleich: bei der FBG Mindelheim sind es jährlich etwa 60.000 Festmeter Holz.
Laut Waldgesetz müssen die Kahlflächen innerhalb von drei Jahren wieder aufgeforstet werden. Doch die Flächengrößen und die Freiflächensituation erschweren die Wiederbewaldung. In einer wissenschaftlichen Untersuchung wurden Bodentemperaturen von über 70 Grad auf der Freifläche gemessen. Baumschulpflanzen haben dort nur eine bedingte Überlebenswahrscheinlichkeit. Für so große Schadgebiete gibt es zudem noch kein „Best-Practice“-Verfahren. Neue Wege der Wiederbewaldung müssen getestet und etabliert werden.
Waldbauliche Lösungsansätze und Konsequenzen im Schadensgebiet
- Einbringung neuer Baumarten:
- Neben der Buche kommt die Rot-, Stiel- und Traubeneiche, sowie die Esskastanie ins Spiel. Sie wachsen schon heute in Regionen, wo das Klima so ist, wie für den Frankenwald prognostiziert wird. Pionierbaumarten wie Birke und Vogelbeere werden gezielt gesät, um einen Vorwald zu begründen. Dieser beschert den eigentlichen Baumarten bessere Wuchsbedingungen als auf der Freifläche.
- Einsatz neuer Technik:
- Versuchsweise wir mit Drohnen gesät. Die Samen sind mit einer Lehmschicht ummantelt. Dies verringert den Abtrag durch Wind und beschert einen Startbonus durch Nährstoffe und mehr Wasser.
- Test- und Anschauungsflächen:
- In Wiederbewaldungsparcours zeigen die Förster, welche Baumarten, Verfahren und Pflanzverbände bei der Wiederbewaldung möglich sind. Hier können sich Interessierte die verschiedenen Varianten der Wiederbewaldung - von der Saat über die Vollpflanzung bis zu Teilpflanzungen - vor Ort ansehen.
- Auf Schauflächen werden verschiedene, zum Teil nicht-heimische Baumarten angepflanzt. Ziel ist, herauszufinden, welche Arten mit den Bedingungen vor Ort so gut zurechtkommen, dass sie Teil des nötigen Waldumbaus sein können.
- Effektivitätssteigerung:
- Die Waldbesitzervereinigungen haben vier standardisierte Pflanzkombinationen und -verfahren entwickelt - je zwei Laub- und zwei Nadelholzdominierte.
- Eine der örtlichen WBVen ist seit kurzem eingetragener Pflanzenhändler. Sie hält 150.000 Pflanzen auf Vorrat, die den vier Standartverfahren entsprechen. Zur Pflanzung arbeitet sie mit einem kooperierenden Unternehmer zusammen. So lassen sich Liefer- und Unternehmerengpässe umgehen.